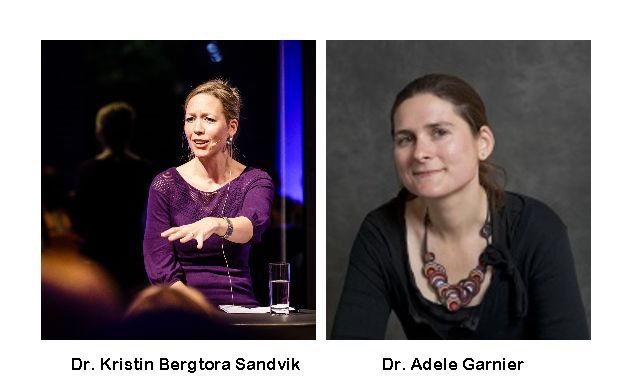Interview mit Ishmeal Alfred Charles, Programm-Manager bei Caritas Freetown in Sierra Leone
Das Ebola-Virus hat Sierra Leone und seine Nachbarländer 2014 in bislang noch nie dagewesenem Ausmaß getroffen. Trotz der Warnungen lokaler Organisationen und von Ärzte ohne Grenzen reagierte die internationale Gemeinschaft nur schleppend auf den eskalierenden Ausbruch, obwohl die nationalen Gesundheitssysteme stark überfordert waren. Das Ebola-Fieber war damals in Sierra Leone noch unbekannt, so wie COVID-19 nun für die meisten betroffenen Länder neu ist. Ishmeal Alfred Charles, Programm-Manager bei Caritas Freetown, hat bei der Bekämpfung der Epidemie in seinem Heimatland mitgeholfen. Im Interview schildert er seine wichtigsten Erkenntnisse und weist auf die generellen Herausforderungen für Gesundheitssysteme bei der Bekämpfung neuartiger Epidemien hin.
Was wird Ihrer Erfahrung nach derzeit in den Ländern des Nordens falsch gemacht, um die Kontrolle über COVID-19 zu erlangen?

Meiner Erfahrung nach verfolgen die Länder des globalen Nordens die Notfallprotokolle nicht streng genug. Viele Länder haben die Situation unterschätzt und zu lange gewartet, um Vorsichtsmaßnahmen, wie z.B. Abriegelungen oder Ausgangssperren, zu ergreifen. Auch 2014 in Sierra Leone zögerten die Menschen, als zu Beginn des Ebola-Ausbruchs Schulen und Colleges geschlossen, gemeinschaftliche Mahlzeiten untersagt oder Gottesdienste in Kirchen und Moscheen kurzzeitig verboten wurden. Während des Ebola-Ausbruchs mussten wir auf schwere Weise lernen, dass dies notwendig ist – etwa 5.000 Menschen starben (nach offiziellen Angaben). Obwohl es aktuell keinen Corona-Fall gibt, hat Sierra Leone bereits alle öffentlichen Versammlungen von mehr als 100 Menschen verboten – sogar sämtliche Gottesdienste, obwohl Religion und Gemeinschaft eine große Rolle in unserer Kultur spielen.
Welche Lehren haben Sie aus dem Ebola-Ausbruch im Jahr 2014 gezogen?
Die Lektionen waren sehr bitter. Wir haben gelernt, einen öffentlichen Gesundheitsnotstand nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn erste Fälle bemerkt werden, läuft man schon sehr schnell auf zweistellige Zahlen zu. Aus Hunderten werden schnell Tausende und dann wird es sehr schwierig, die Ausbreitung einzudämmen. Dann können Gesundheitssysteme schnell überfordert sein, die vielen Fälle zu bewältigen.
Die UNO hat einen Finanzierungsaufruf von 2 Milliarden US-Dollar für eine weltweite Reaktion auf COVID19 gestartet, eine große Summe, aber weniger als das, was das Bundesland Niedersachsen von der Bundesregierung erhält. Glücklicherweise hat Sierra Leone aktuell noch keine Corona-Fälle. Was aber befürchten Sie, wenn Corona Sierra Leone in größerem Umfang betrifft und die globale Aufmerksamkeit nicht einmal auf die Situation und ihre Folgen in Orten wie Idlib, Syrien oder Cox Bazaar, Bangladesch, gerichtet ist?
In Sierra Leone ist soweit noch kein Fall vom Corona-Virus aufgetreten, aber natürlich sind wir besorgt. Wir sind sehr vorsichtig und treffen Vorkehrungen. So haben wir beispielsweise Flughäfen und den Luftraum gesperrt. Aber die Folgen der Pandemie treffen uns bereits jetzt sehr stark. Wenn wir uns zu sehr auf die Eindämmung des Virus konzentrieren, verlieren wir die wirtschaftlichen und sozialen Prioritäten aus den Augen, die für viele Länder, aber auch für unser Land, schlimm sind. Die wirtschaftliche Lage in Sierra Leone ist bereits sehr angespannt. Die Preise für Rohstoffe wie Milch und Zucker sind gestiegen und werden sich weiter vervielfachen, weil nicht abzusehen ist, wann die Pandemie zu Ende geht. Familien, die auf Geldtransfers von Verwandten in anderen Ländern angewiesen sind, erhalten nicht die Unterstützung, die sie normalerweise erhalten. Wir befürchten, dass viele Menschen von Ernährungsunsicherheit und Armut betroffen sein werden (siehe auch die Studie des Global Policy Forum). Auch gibt es viel Angst und Panik: In den sozialen Medien werden falsche Nachrichten verbreitet, was zu politischen Spannungen führt.
In Deutschland befürchten Ärzte, dass die Menschen selbst bei schweren Erkrankungen Krankenhäuser meiden, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Wie haben Sie die Herausforderung gemeistert, die Bedürfnisse von Ebola-Patienten und die von Normalpatienten in einem überforderten Gesundheitssystem in Einklang zu bringen?
Es gab einen öffentlichen Aufschrei, als ein Mädchen für eine heilbare Krankheit keine Hilfe erhielt und aufgrund von Komplikationen kurze Zeit später starb. Dies war in den nationalen Nachrichten zu sehen und machte viele junge Menschen wütend. Viele Menschen wurden während des Ausbruchs 2014 bei Routinebehandlungen wie Schwangerschaft oder Bluthochdruck von den Gesundheitszentren abgewiesen. Dies führte dazu, dass mehr Menschen an anderen Krankheiten als Ebola starben. Auch verschwiegen einige Ärzt*innen und Pflegekräfte aus Angst und Stigmatisierung ihren Beruf, was leider zu mehr Todesfällen führte.
Eine der Herausforderungen in jeder gesundheitlichen Notlage ist die Frage des Vertrauens. Die Menschen müssen darauf vertrauen, dass das Gesundheitssystem oder die Behörden die Krise wirksam bewältigen und andere Bürger bei den Präventivmaßnahmen mitziehen. Was waren die größten Herausforderungen in dieser Hinsicht und was haben Sie daraus gelernt?
Die Frage des Vertrauens war sehr wichtig, weil viele falsche Informationen verbreitet wurden, darunter Hexerei, Falschnachrichten oder Verschwörungstheorien. Die Leute dachten zum Beispiel, dass Gott sie wegen der Sünden, die sie begangen hatten, mit Ebola infiziert hätte. Aber auch das Vertrauen in offizielle Informationen von Regierungsbehörden war gering. Anfangs hieß es, dass Ebola nicht heilbar sei. Aber dann gab es Menschen, die von einer Ebola-Infektion gesundeten, diese also überlebten. Daher erschien der Bevölkerung auch die offizielle Kommunikation als unzuverlässig.
Durch die Abstimmung der Informationen mit verschiedenen Stakeholdern und die Einbeziehung religiöser Anführer wie Imame und Priester, denen die Gemeinden vertrauten, konnten wir die Verbreitung von Fehlinformationen stoppen und das Vertrauen der Menschen in die Echtheit von Ebola stärken. Religiöse Anführer teilten mit, dass es gefährlich ist, Tote zu waschen, und dass man sich oft die Hände waschen muss usw. Dies führte zu einem drastischen Rückgang der Neuinfektionen mit dem Ebola-Virus und war ein grundlegender Schritt zur Kontrolle des Ausbruchs. So konnten wir dazu beitragen, das Vertrauen der Menschen in unser Gesundheitssystem wieder herzustellen.
Sierra Leone wurde 2015 für Ebola-frei erklärt, welche Herausforderungen gibt es noch?
Eine der wichtigsten Herausforderungen, die nach wie vor besteht, ist die Versorgung der Überlebenden. Es gibt in Sierra Leone 4.050 Ebola-Überlebende, etwa 11.000 Waisen und Hunderte von Witwen, von denen viele auf externe Unterstützung angewiesen sind. Zum einen sind sie immer noch mit vielen Stigmata konfrontiert. Manche Menschen glauben immer noch, dass die Überlebenden auch diejenigen waren, die die Krankheit verbreiteten. Darüber hinaus benötigen viele Überlebende auch kontinuierliche medizinische Unterstützung, um Nebenwirkungen zu behandeln, die aus ihrer Virusinfektion resultieren, wie z.B. schmerzende Gelenke oder Augen. Viele sind auch mit wirtschaftlicher Not und Armut konfrontiert. Wir versuchen sie durch mobile Kliniken, aber auch durch Programme zur Sicherung des Lebensunterhalts und psychosoziale Unterstützung zu unterstützen, um ihren Leben wiederaufzubauen und das Vertrauen wiederherzustellen. Die Herausforderungen werden in den Ländern des Nordens teils andere sein, aber es ist jetzt schon wichtig, auch über die Zeit nach der Pandemie und ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen nachzudenken.
Das Interview wurde am 27. März 2020 von Sonja Hövelmann geführt.
Weiterführende Literatur
- HPG (2015) Ebola response in West Africa. Exposing the politics and culture of international aid.
- HPN (2020) Responding to Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo.
- Welt-sichten (2020). Unsichtbare Viren, fremde Helfer.